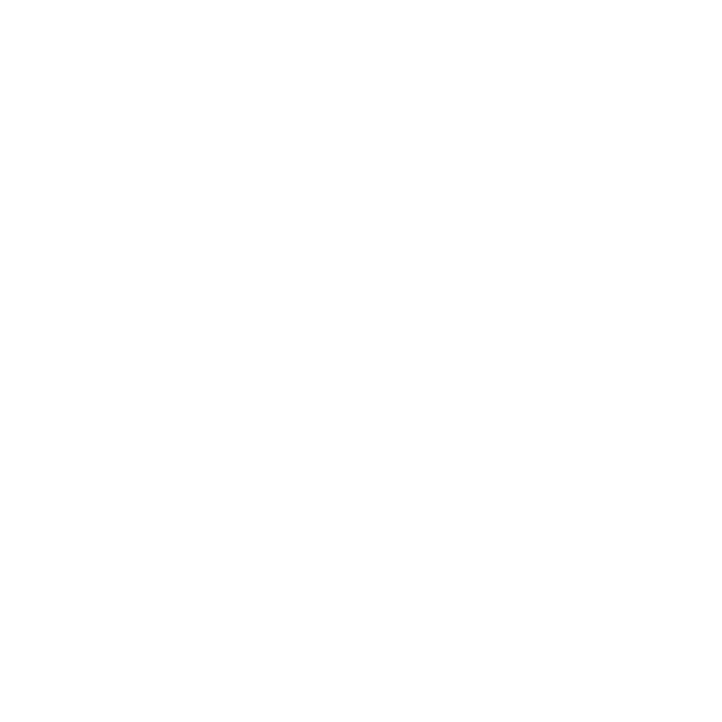Themen: Termine der Bundeskanzlerin (Videokonferenz mit dem Premierminister von Portugal und dem Ministerpräsidenten von Slowenien, Kabinettssitzung, Kabinettsausschuss für Digitalisierung), Coronapandemie (Corona-Warn-App, Ausbruch von COVID-19 bei der Firma Tönnies, Erstattung von Beratungskosten für Kleinunternehmer), Atomabkommen mit Iran, Auftragsmord im Tiergarten in Berlin, Treffen des Bundesverkehrsministers mit Vertretern des US-Unternehmens Augustus Intelligence, Rückzug der USA aus den OECD-Verhandlungen über eine Digitalsteuer, Lage in Libyen, Gespräch zwischen dem weißrussischen Außenministerium und den Botschaftern der EU-Länder in Minsk, Wirecard, Lufthansa, Gründung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Berliner Antidiskriminierungsgesetz, US-Sanktionen gegen Syrien, Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus Griechenland
Ohne naive Fragen heute.
Bitte unterstützt unsere Arbeit finanziell:
Konto: Jung & Naiv
IBAN: DE854 3060 967 104 779 2900
GLS Gemeinschaftsbank
PayPal ► http://www.paypal.me/JungNaiv
Komplettes BPK-Wortprotokoll vom 19. Juni 2020:
SRS’IN DEMMER: In bewegten Zeiten sind bei den Terminen der Bundeskanzlerin natürlich immer Änderungen vorbehalten. Aber darüber würden wir Sie dann rechtzeitig informieren.
Im Vorfeld der deutschen EU-Ratspräsidentschaft tauscht sich die Bundeskanzlerin am Dienstag, den 23. Juni, ab 11 Uhr in einer Videokonferenz mit dem Premierminister von Portugal, António Costa, und dem Ministerpräsidenten von Slowenien, Janez Janša, aus. Wie Sie wissen, wird Deutschland am 1. Juli 2020 turnusgemäß für ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat der EU übernehmen. Uns folgen dann Portugal und Slowenien. Gemeinsam mit Portugal und Slowenien bilden wir die sogenannte EU-Trioratspräsidentschaft vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2021.
Diese Auftakttreffen der drei Regierungschefs finden vor Beginn einer neuen Triopräsidentschaft regelmäßig statt, wenn auch normalerweise natürlich nicht virtuell; das ist den Folgen der Pandemie geschuldet.
Am Dienstag wird die Bundeskanzlerin mit ihren beiden Kollegen über Themen sprechen, die Schwerpunkte der gemeinsamen Triopräsidentschaft betreffen und die im sogenannten Trioprogramm festgehalten sind. Unser gemeinsames Ziel mit Portugal und Slowenien ist, dass Europa stärker, solidarischer und nachhaltiger aus der Krise herauskommt, als es hineingegangen ist.
Am Mittwoch findet zunächst, wie gewohnt, unter der Leitung der Bundeskanzlerin um 9.30 Uhr die Sitzung des Kabinetts statt.
Im Anschluss daran trifft der Kabinettsausschuss für Digitalisierung zu seiner vierten Sitzung zusammen. Die Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, das alle Bereiche von Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung erfasst. Deshalb betrifft sie auch alle Ressorts der Bundesregierung.
Die wichtigen Fragen, die sich aus dem Digitalisierungsprozess ergeben, müssen ressortübergreifend beraten, koordiniert und beantwortet werden. Dazu ist ein regelmäßiger Austausch nicht nur auf Fach-, sondern auch auf Ministerebene notwendig. Die wöchentliche Kabinettssitzung ist angesichts der Komplexität und des zeitlichen Beratungsbedarfs nicht das geeignete Forum. Deswegen ist zusätzlich das Digitalkabinett ins Leben gerufen worden.
Auf dieser Sitzung wollen die Mitglieder über folgende Punkte beraten: aktueller Stand sowie weiterer Prozess der Umsetzungsstrategie „Digitalisierung gestalten“, Bericht über den Stand zum Digitalisierungsprogramm Bund, Erfahrungen der Bundesbehörden zur papierlosen Kommunikation und ein Zwischenbericht der interministeriellen Arbeitsgruppe „Personal in der digitalen Verwaltung“. Dann folgen noch ein aktueller Stand sowie der weitere Prozess zur Datenstrategie der Bundesregierung.
Vorsitzende des Gremiums ist die Bundeskanzlerin, stellvertretender Vorsitzender ist der Vizekanzler und Bundesminister Scholz. Der beauftragte Vorsitz obliegt dem Chef des Bundeskanzleramts. Alle Bundesministerinnen und Bundesminister sowie die Staatsministerin für Digitalisierung und der Chef des Presse- und Informationsamtes, der ja regelmäßig hier auf diesem Platz sitzt, sind ständige Mitglieder des Kabinettsausschusses für Digitalisierung.
Ich freue mich über 9,6 Millionen Downloads der Corona-Warn-App. Das ist ein starker Start und ein Zeichen für die durchwegs hohe Akzeptanz. An dieser Stelle darf ich nicht auslassen zu sagen, dass es natürlich keine Vorgaben für irgendwelche Mindestnutzerzahlen gibt, sondern jeder Nutzer nützt. Der Download und die Nutzung sind natürlich weiterhin freiwillig. Jeder, der mitmacht, hilft. Wie gesagt: Wir freuen uns über 9,6 Millionen Downloads.
Damit wäre ich durch.
FRAGE STAUSS: Ich habe eine Frage an das Gesundheitsministerium zur Firma Tönnies: Wie reagieren Sie auf die Entwicklungen dort, und muss da gesetzgeberisch noch mehr gemacht werden?
GÜLDE: Vielen Dank für die Frage. Wir nehmen das Ausbruchsgeschehen im Kreis Gütersloh sehr ernst. Jetzt kommt es natürlich darauf an, möglichst schnell die Infektionsketten zu unterbrechen. Deswegen war es auch richtig, dass im Kreis Gütersloh jetzt in großem Maßstab Reihentests angeordnet wurden. Dies zu ermöglichen das wissen Sie , war unser Ziel mit der jüngsten Testverordnung, die wir auf den Weg gebracht haben. Unklar ist allerdings noch, wie sich das Virus in dem Schlachtbetrieb so schnell ausbreiten konnte. Das wird derzeit von den Behörden vor Ort ermittelt. Die Untersuchungen dazu laufen noch.
ZUSATZFRAGE STAUSS: Sieht Ihr Ministerium den Bedarf, dass das Gesetz, das kommen soll, früher kommen muss?
GÜLDE: Das würde ich gerne an das Arbeitsministerium weitergeben. Dazu kann ich jetzt leider nichts sagen.
SCHNEIDER: Ich kann dem, was der Minister schon gestern öffentlich gesagt hat, eigentlich nichts hinzufügen. Er hat deutlich gemacht, dass Corona gezeigt hat, welchen Bedarf wir hier haben, und dass wir jetzt hier Veränderungen brauchen, vor allem was den Arbeitsschutz der Beschäftigten in der Fleischbranche anbelangt. Er hat das Gesetz angekündigt und noch einmal klargemacht, dass das jetzt so schnell wie möglich kommen soll. Sie wissen, es gibt dazu schon einen Kabinettsbeschluss, was die Eckpunkte anbelangt. Die Bundesregierung hat also nach den ersten Ausbrüchen, die wir in unterschiedlichen Regionen gesehen haben, sehr schnell gehandelt. Jetzt gilt es, den Gesetzentwurf zu erarbeiten. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. Der Minister hat gesagt, dass das Gesetz so schnell wie möglich kommt.
FRAGE DR. RINKE: Was heißt „so schnell wie möglich“? Ist es vorstellbar, dass das Gesetz noch vor der Sommerpause kommt? Ist es angesichts der Bedrohung durch das und der Ausbreitung des Coronavirus vorstellbar, dass man eine Sondersitzung des Bundestages macht? Das ist die eine Frage.
Die zweite Frage richtet sich an das Gesundheitsministerium, weil Sie sagen, es sei unklar, wie sich das Virus in dem Schlachthof ausbreiten konnte. Ist das ein Indiz dafür, dass die Gefahr der Ansteckung bei sinkenden Temperaturen wieder steigt? Denn einige sagen ja, das hängt auch mit den niedrigen Temperaturen in Schlachthöfen zusammen.
SCHNEIDER: Ich fange einmal an. Ich kann den Zeitplan jetzt nicht näher konkretisieren. „So schnell wie möglich“ heißt natürlich so schnell wie möglich. Wie gesagt: Wir arbeiten mit Hochdruck an diesem Gesetz. Ich möchte noch einmal unterstreichen: Die Bundesregierung hat sehr schnell gehandelt und sehr schnell Eckpunkte für dieses Gesetz vorgelegt. Dazu noch kurz der Hinweis, dass der erste Punkt der vorgelegten Punkte bereits gestern vom Bundestag beschlossen worden ist. Das betrifft das Projekt „Faire Mobilität“.
Was den Punkt Leiharbeit und Werkverträge betrifft: Da sind wir wirklich mit Hochdruck dran. Da gibt es jetzt noch eine ganze Reihe an Fragen zu klären, auch in Zusammenarbeit mit den anderen Ressorts.
Wie gesagt: Wir sind dran. Dieses Gesetz wird es so schnell wie möglich geben. Ich gehe davon aus, dass das im Sommer der Fall ist. Aber ich kann Ihnen keinen konkreten Zeitpunkt nennen.
GÜLDE: Zu der Frage der Ursache der Ausbrüche insbesondere in den Schlachtbetrieben: Darüber zu spekulieren mag ich mir jetzt nicht anmaßen. Sie wissen, es ist derzeit Gegenstand der Forschung, welche Ursachen es gibt, dass sich dieses Virus gerade in Schlachtbetrieben so schnell ausbreiten kann. Da werden die Arbeitsbedingungen immer wieder ins Feld geführt, auch die Temperaturen. Das ist Gegenstand der Forschung. Wie gesagt: Die genauen Hergänge in Gütersloh werden derzeit durch die örtlichen Behörden ermittelt. Das Robert-Koch-Institut steht auch mit dem Gesundheitsamt vor Ort in sehr engem Austausch.
ZUSATZFRAGE DR. RINKE: Da es jetzt wiederholt Ausbrüche in Schlachthöfen gab und eine gesetzliche Regelung noch ein bisschen auf sich warten lässt sie kommt vielleicht im Sommer, möglicherweise in ein paar Wochen : Ist jetzt eine Anordnung ergangen, oder dringt die Bundesregierung darauf, dass die Landesbehörden wirklich jeden Schlachthof jede Woche untersuchen? Denn das Problem dort scheint ja gewesen zu sein, dass eine Untersuchung stattgefunden hat, dann eine Weile nicht, und dann hat man die Ausbreitung festgestellt. Gibt es Überlegungen, dass man die Landesbehörden entweder anweist oder bittet, wirklich einen regelmäßigen Check in Schlachthöfen vorzunehmen?
GÜLDE: Die Untersuchung von Schlachthöfen liegt in der Zuständigkeit der Länder. Mir ist jetzt ein solches Anliegen oder eine solche Bitte seitens des Bundes, ehrlich gesagt, nicht bekannt.
FRAGE TOWFIGH NIA: Herr Burger, ich habe eine Frage zum Iran: Heute soll in Berlin ein Dreier-Außenministertreffen zum Thema Iran stattfinden. Können Sie dazu Näheres sagen? Warum findet das gerade zum jetzigen Zeitpunkt statt?
BURGER: Wir hatten Ihnen gestern mit einer Pressemitteilung angekündigt, dass der französische Außenminister heute in Berlin zu einem bilateralen Treffen ist. Im Anschluss daran wird es auch noch ein gemeinsames Gespräch mit dem britischen Außenminister geben, der ebenfalls nach Berlin kommt. Ein Thema dieses Gesprächs ist unter anderem der Iran. Sie wissen, dass wir uns im E3-Kreis kontinuierlich zu diesem Thema beraten. Ich will dem Gespräch jetzt nicht vorgreifen. Aber Sie kennen den Diskussionsstand und die Bemühungen um den Erhalt des JCPOA und dass Iran zur vollen Umsetzung des JCPOA zurückkehrt. Das ist natürlich auch heute Gegenstand der Gespräche.
ZUSATZFRAGE TOWFIGH NIA: Nun wird ja auch in der IAEO eine Resolution gegen Iran vorbereitet. Sehen Sie jetzt die Zukunft des JCPOA in Gefahr?
BURGER: Die von den E3 eingebrachte Resolution, die Sie ansprechen, ist soeben im IAEO-Gouverneursrat mit einer soliden Mehrheit, mit etwas mehr als zwei Dritteln, angenommen worden. Das begrüßen wir natürlich. Diese E3-Resolution stärkt der IAEO und ihrem Generaldirektor Grossi den Rücken. Sie fordert Iran zur vollständigen Kooperation und die IAEO zur weiteren Berichterstattung auf. Damit wollen wir erreichen, dass Iran die von der IAEO geforderten Zugänge zu nicht deklarierten Stätten gewährt und konstruktiv daran mitwirkt, nicht deklariertes Uranmaterial aufzuklären.
FRAGE: Es geht um den Auftragsmord im Tiergarten im letzten Sommer. Der Außenminister hat gestern angedeutet, dass weitere Maßnahmen gegenüber Russland möglich wären. Können Sie uns sagen, was da denkbar wäre?
Die zweite Frage ist, ob bei der Entscheidung über die deutsche Reaktion die Auswahl der Waffen eine Rolle spielen wird. Im Fall Skripal in Großbritannien wurden biologische Waffen eingesetzt. Dabei sind auch unbeteiligte Dritte zu Schaden gekommen. In Berlin wurde eine Schusswaffe eingesetzt, die keine Gefahr für die Bevölkerung dargestellt hat, weder davor noch danach. Danke.
VORS. DETJEN: Ich füge hinzu, dass in diesem Zusammenhang auch eine Frage nach der Einbestellung des russischen Botschafters gestellt wurde. Außerdem wurde die Frage gestellt, ob vonseiten der Bundesregierung neue Maßnahmen gegenüber Russland getroffen werden.
BURGER: Ich kann Sie nur noch einmal auf die Äußerungen des Außenministers von gestern und auf das verweisen, was gestern vonseiten des BPA dazu mitgeteilt wurde. Der Außenminister hat gesagt, dass das ein außerordentlich schwerwiegender Vorgang ist und dass es deswegen wichtig bzw. sogar unabdingbar ist, dass dieser Vorgang von den Justizbehörden und den Gerichten umfassend und abschließend in einem Urteil aufgeklärt wird. Er hat auch gesagt, dass wir uns weitere Maßnahmen in diesem Fall ausdrücklich vorbehalten. Ich kann und möchte an dieser Stelle jetzt nicht weiter dazu ausführen.
Sie haben das Gespräch mit dem russischen Botschafter gestern erwähnt. Das hat der Außenminister gestern mit den Worten angekündigt, dass wir der russischen Seite in diesem Rahmen unsere Haltung noch einmal unmissverständlich darlegen. Das hat gestern auch so stattgefunden.
FRAGE: Ich habe eine Frage in Bezug auf das Treffen des Bundesaußenministers in Berlin: Welche Verpflichtungen hat die Bundesrepublik Deutschland bisher nach dem Austritt der USA in Bezug auf das Nuklearabkommen mit dem Iran erfüllt? Das ist die erste Frage.
Die zweite Frage ist: Sind die einseitigen Erwartungen, die man immer gegenüber Iran ausdrückt, nicht ein Widerspruch zu dem Gerechtigkeitsprinzip? Man fordert Iran ja immer auf dabeizubleiben, während sich die USA aus dem Abkommen verabschiedet haben.
Eine andere Frage ist: Was ist eigentlich aus INSTEX geworden? Es war ja eigentlich vorgesehen, dass die Geschäfte weiterlaufen. Aber bei dieser Institution hat der Leiter dreimal gewechselt. Wo befindet sich INSTEX heute?
BURGER: Deutschland hält seine eigenen Verpflichtungen aus dem JCPOA vollumfänglich ein. Daran hat sich nichts geändert. Den Ausstieg der USA aus dem JCPOA haben wir bedauert und bedauern wir weiterhin. Wir sind der Meinung, dass das JCPOA der beste und aussichtsreichste Weg ist, um zu verhindern, dass sich Iran Zugang zu Atomwaffen verschafft, und es gleichzeitig der beste und aussichtsreichste Weg ist, auf diese Weise eine weitere Eskalation in der Region des Nahen und Mittleren Ostens zu vermeiden. Deswegen sind wir der Meinung, dass alle Seiten ein Interesse daran haben müssen auch die große Mehrheit der internationalen Gemeinschaft stellt sich immer wieder hinter das JCPOA , dass dieses Abkommen erhalten bleibt.
Zu INSTEX: Ich konnte die Frage akustisch nicht völlig verstehen. Sie wissen, dass es erste Transaktionen über das Instrument INSTEX gab. Die Arbeiten an weiteren Folgetransaktionen sind im Gange.
ZUSATZFRAGE: In Bezug auf INSTEX ist ja vieles versprochen worden, aber in der Realität ist dabei kaum etwas Konkretes herausgekommen. Deshalb ist die Frage: Wo befindet sich INSTEX jetzt?
BURGER: INSTEX ist vor einigen Monaten ich habe jetzt das Datum, ehrlich gesagt, nicht im Kopf; aber Sie erinnern sich sicherlich in Betrieb genommen worden. Derzeit laufen die Arbeiten daran, dass es weitere Finanztransaktionen mit diesem Instrument gibt.
ZUSATZFRAGE: Sie haben meine zweite Frage nach dem Gerechtigkeitsprinzip in Bezug auf den Iran noch nicht beantwortet. Das wird eigentlich nicht berücksichtigt, wenn man Iran ständig zum Verbleib in diesem Abkommen auffordert, während sich die USA davon getrennt haben.
BURGER: Wie gesagt: Dass die USA aus dem JCPOA ausgestiegen sind, haben wir bedauert, und wir bedauern es weiterhin. Deutschland, die Europäische Union und die anderen Teilnehmer am JCPOA halten sich weiterhin an ihre Verpflichtungen. Wir erwarten auch von Iran, dass er dies tut. Wir sind auch der Auffassung, dass es im Interesse aller Seiten ist, dass das JCPOA weiter Bestand hat, weil es aus unserer Sicht ein Beitrag zur Sicherheit und Stabilität in der Region ist. Deswegen erwarten wir auch von Iran, dass er seine Verpflichtungen weiter einhält.
FRAGE DR. RINKE: Herr Burger, ich habe noch eine Nachfrage zu dem Thema Russland und dem Mord im Tiergarten. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Sanktionen oder die möglichen weiteren Schritte der Bundesregierung erst nach dem Abschluss des Gerichtsverfahrens erfolgen? Sie haben darauf verwiesen, dass man jetzt abwarten wolle, wie die juristische Auseinandersetzung weitergeht.
BURGER: Der Außenminister hat gesagt: Die Bundesregierung behält sich weitere Maßnahmen in diesem Fall ausdrücklich vor. Ich will das an dieser Stelle jetzt nicht weiter spezifizieren.
ZUSATZFRAGE DR. RINKE: Hatten Sie in Ihrer Antwort nicht gesagt deswegen frage ich jetzt nach , dass man jetzt erst einmal das juristische Verfahren abwarten wolle? Das würde ja heißen, dass man tatsächlich erst einmal eine gewisse Zeit verstreichen lässt, bevor man dann mögliche Maßnahmen verhängt.
BURGER: Ich habe darauf hingewiesen, dass die gerichtliche Aufarbeitung dieses Vorgangs natürlich sehr wichtig ist. Wir wollen, dass das umfassend aufgeklärt wird und dass auch die Schuldfrage in Form eines gerichtlichen Urteils klar geklärt wird. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass wir uns weitere Maßnahmen vorbehalten.
FRAGE DR. ROSE: Wie kommentiert die Bundesregierung die Meldung zur Anklageerhebung durch den Generalbundesanwalt?
FRAGE: Verstehe ich Sie richtig, dass momentan keine weiteren Maßnahmen geplant sind?
BURGER: Vielleicht erinnere ich noch einmal daran, dass wir schon bei der Aufnahme der Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt eine Reihe von Maßnahmen getroffen haben. Wir haben mit Ausweisungen von russischen Diplomaten reagiert, und wir haben mit Bezug auf den Hackerangriff und gleichzeitig auch mit Blick auf den Tiergartenmord die Listung von Personen und Entitäten, die damit in Zusammenhang stehen unter dem EU-Cybersanktionsregime angestoßen bzw. beantragt.
Jetzt ist der Generalbundesanwalt in demselben laufenden Verfahren einen weiteren Verfahrensschritt gegangen und hat Anklage erhoben. Wir verfolgen das aufmerksam und behalten uns wie gesagt weitere Schritte vor.
ZUSATZFRAGE: Entschuldigen Sie, der Cyberangriff war kein Gegenstand der Anklage der Generalbundesanwaltschaft gestern. Das ist ein anderer Fall.
Meine Frage ist: Sind im Zusammenhang mit dem Mord im Tiergarten weitere Maßnahmen der Bundesregierung geplant oder nicht?
BURGER: Dann habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass der Cyberangriff auf den Bundestag in Zusammenhang mit dem Tiergartenmord steht, sondern ich habe umgekehrt gesagt, dass die Listungsvorschläge, die die Bundesregierung Ende Mai unter dem EU-Cybersanktionsregime gemacht hat damals hatten wir dazu auch eine Pressemitteilung herausgegeben, die ich Ihnen gern noch einmal zur Verfügung stellen kann , einerseits mit Blick auf den Bundestagshack, aber andererseits auch mit Blick auf den Tiergartenmord vorgenommen wurden. Das war es, was ich sagen wollte, nicht umgekehrt.
ZUSATZFRAGE: Habe ich Sie also richtig verstanden, dass keine weiteren Maßnahmen geplant sind?
BURGER: Wir behalten uns weitere Maßnahmen ausdrücklich vor. Das ist es, was der Außenminister gesagt hat.
FRAGE DR. RINKE: Suchen Sie eine europäische Abstimmung? Auch das wurde gestern ja schon vorgeschlagen. Die Briten sind diesen Weg damals nach dem Giftanschlag in Salisbury gegangen. Gab es dazu schon Gespräche mit den EU-Partnern, oder sind sie geplant?
BURGER: Ich habe ja das EU-Cybersanktionsregime genannt. Das ist natürlich ein gemeinsames europäisches Instrument, das wir nutzen und in dem die Gespräche und Verhandlungen auch laufen. Natürlich tauscht man sich in den Gesprächen mit engen Partnern auch über die Bewertung solcher Vorfälle aus. Aber zu Maßnahmen, die wir uns jetzt noch vorbehalten, kann ich heute wie gesagt keine weiteren Details nennen.
FRAGE ROSSMANN: Wann hat Herr Scheuer Vertreter der Firma Augustus getroffen? Was war der Anlass für das Treffen?
Ist dieses Treffen wie im Fall des Bundeswirtschaftsministeriums unter Beteiligung von Herrn Amthor zustande gekommen?
STRATER: Vielen Dank. Wir haben uns dazu gestern schon schriftlich geäußert, auch über die sozialen Medien. Ich wiederhole das hier gern.
Was ist die Geschichte? Der Minister, der für moderne Mobilität zuständig ist, trifft sich mit einem Start-up, weil das zu seinem Job gehört, nämlich offen zu sein für innovative Ideen. Vorweg: Solche Treffen sind also keineswegs etwas Ungewöhnliches.
Auch vorweg: Was hat die Firma Augustus Intelligence davon gehabt? Finanziell gar nichts. An besagtes Start-up floss kein Geld. In Zahlen: null Cent. Das Unternehmen war und ist nicht Teil einer finanziellen Unterstützung oder Förderung durch das BMVI.
Was haben das BMVI oder der Minister von diesen Treffen, die ich gleich nennen werde? Grundsätzlich die Perspektive eines Start-ups hier geht es um das Thema der künstlichen Intelligenz und ganz konkret die Kenntnis und die Expertise zur Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz auf den internationalen Märkten, zu „deep learning“, Datenplattformen oder Blockchain.
Was war der Anlass? Das BMVI hat im vergangenen Jahr einen Aktionsplan „Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Mobilität“ erarbeitet und damit die Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung unterstützt. In diesem Zusammenhang gab es Gespräche und Austausch mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen, zum Beispiel am 26. September 2018 in Berlin. Dabei handelte es sich um einen Gedankenaustausch zwischen Experten. Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft wurden gesucht, um aus verschiedenen Perspektiven vom Start-up bis zum Großunternehmen über die Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz im Mobilitätsbereich national und international zu diskutieren.
Wesentliches Kriterium bei der Auswahl dieser Experten war die Fachkompetenz. Ich nenne hier die bei diesem Gedankenaustausch anwesenden Unternehmen. Zu den Eingeladenen und auch Anwesenden gehörte neben BMW, Bosch, Cargonexx, der Deutschen Bahn, der Deutschen Telekom sowie Vertretern der Wissenschaft, beispielsweise dem Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme und der Technischen Universität Berlin, eben auch Augustus Intelligence. Augustus Intelligence war in persona von Herrn Pascal Weinberger und Dr. Wolfgang Haupt vertreten. Über diesen Termin wurde und wird weiterhin auf unserer Webseite informiert. Das können Sie sich gern ansehen.
Vor diesem Expertengespräch gab es am 9. Juli 2018 auch das haben wir gestern bereits kommuniziert ein erstes Kennenlerngespräch im BMVI, auch mit Herrn Weinberger, Herrn Haupt, dem Minister und weiteren Fachleuten unseres Hauses.
Die Antwort auf die Frage, ob Herr Amthor bei dieser Kontaktvermittlung geholfen hat, ist nein.
FRAGE SZENT-IVÁNYI: Wie bewertet das Bundesfinanzministerium die Absage der USA an weitere Verhandlungen über eine Digitalsteuer?
DR. KUHN: Das Bundesfinanzministerium setzt sich weiterhin mit Nachdruck für eine Lösung ein, die die steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung angemessen adressiert und zu einer fairen Besteuerung führt. Alle Staaten einschließlich der USA haben immer wieder betont, dass sie eine international abgestimmte Lösung anstreben. Die Verhandlungen dazu laufen derzeit.
Wie in jedem Verhandlungsprozess gibt es auch hier Punkte, die wir gemeinsam zu klären haben. Genau daran arbeiten wir jetzt auch. Dazu stimmen wir uns mit unseren internationalen Partnern weiterhin eng ab.
Nach wie vor haben die steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung internationale Ursachen und können daher am besten auf internationaler Ebene gelöst werden. Die OECD-Arbeiten, die hierzu im Auftrag der G20 vorgenommen worden sind, sind bereits weit fortgeschritten.
Wesentlicher Bestandteil für uns und auch das BMF ist dabei die Einführung einer effektiven globalen Mindestbesteuerung. Mit diesem Instrument wollen wir sicherstellen, dass große Unternehmen, auch solche der Digitalbranche, einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben leisten. Dieser Vorschlag, den Deutschland und Frankreich gemeinsam initiiert haben, erfährt weiterhin breite internationale Zustimmung.
FRAGE DR. RINKE: Die EU-Kommission hat nach dem amerikanischen Rückzug bekanntgegeben, dass man ohne die Amerikaner noch in diesem Jahr einen Vorschlag für eine Digitalsteuer vorlegen wolle, notfalls im Alleingang.
Unterstützt die Bundesregierung diese Planung, oder plädiert sie dafür, dass man sich mehr Zeit lässt?
DR. KUHN: Man muss, denke ich, zunächst einmal die beiden Ebenen unterscheiden. Wir haben den OECD-Prozess. Vorrangig ist das Ziel, dass wir auf OECD-Ebene eine internationale Lösung erreichen. Ich habe ja gerade betont, dass die Probleme und Ursachen internationaler Natur sind. Deswegen kann es am besten international, also global gelöst werden.
Was die Europäische Kommission angeht, so hat sie innerhalb der Europäischen Union das Vorschlagsrecht für Gesetzgebungsinitiativen. Wir als Bundesregierung setzen uns dann mit den Vorschlägen auseinander, wenn die Kommission sie vorlegen wird.
ZUSATZFRAGE DR. RINKE: Die Amerikaner gehören ja zur OECD. Wenn die USA jetzt nicht mehr mitmachen, dann klingt es zumindest auf den ersten Blick sehr optimistisch, wenn nicht sogar naiv, dass man noch am OECD-Prozess festhält. Es geht ja genau deswegen darum, dass die Europäer anscheinend bereit sind, einen Alleingang zu gehen.
Interpretiere ich Sie richtig, dass Sie als Finanzministerium nicht für diesen europäischen Alleingang sind?
DR. KUHN: Da kann ich jetzt auf das verweisen, was der Minister im Mai des letzten Jahres gesagt hat. Da hat er gesagt: Wenn der Durchbruch auf OECD-Ebene wider Erwarten nicht gelingt, sind wir Europäer vorbereitet. Wir sind uns jetzt schon einig, dass wir dann in Europa handeln werden. – Gleichzeitig hat er aber auch betont, dass eine international abgestimmte Lösung vorzugswürdig ist, damit ein Flickenteppich widersprüchlicher Regelungen verhindert wird. Bundesfinanzminister Scholz hält daran fest, dass es eine faire Besteuerung geben muss und dass auch internationale Digitalkonzerne ihren Anteil zum Gemeinwesen beitragen müssen. Auch die USA haben in diesem Kontext ja immer wieder betont, dass eine internationale Lösung anzustreben ist.
FRAGE TOWFIGH NIA: Ich habe eine Frage zu Libyen. Herr Burger, das US-Militär, das für Afrika zuständig ist, AFRICOM, hat berichtet, dass gestern zum ersten Mal russische Kampfjets zum Einsatz im Libyen-Krieg gekommen sind. Gibt es dazu eine Stellungnahme? Wird das Thema heute Nachmittag auch eine Rolle spielen?
Wie betrachten Sie die Rolle Russlands in diesem Konflikt grundsätzlich? Auf der einen Seite sagen Sie ja immer, Russland spiele eine Schlüsselrolle. Jetzt ist Russland aber auch militärisch in dem Land aktiv. Wie betrachten Sie diese widersprüchliche Rolle Russlands in Libyen?
BURGER: Über die Meldungen, auf die Sie sich beziehen, die vonseiten des US-Militärs stammen sollen, habe ich keine eigenen Erkenntnisse. Vielleicht kann ich etwas nachliefern, wenn wir dazu eine eigene Einschätzung haben sollten.
Zu Ihrer Frage nach der Rolle Russlands: Ich habe hier auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass Russland eines der Länder ist, die eine wichtige Rolle im Berliner Prozess spielen, weil wir ja im Berliner Prozess ausdrücklich die Staaten eingeladen und mit an den Tisch geholt haben, die in Libyen Einfluss nehmen. Zu diesen Staaten gehört Russland. Wie bei allen anderen Staaten, die in Libyen Einfluss haben und Einfluss nehmen, ist unsere klare Erwartung, dass militärische Unterstützung für die Konfliktparteien dort eingestellt wird und alle ihren Einfluss auf die Konfliktparteien nutzen, um sie dazu zu bewegen, von einer militärischen Logik, die jetzt dort seit Jahren ergebnislos herrscht und immer noch größeres Leid unter der Zivilbevölkerung hervorruft, auf eine politische Logik umzuschalten, nämlich die eines Waffenstillstands und von Gesprächen in dem Rahmen, den der Berliner Prozess dafür geschaffen hat.
ZUSATZFRAGE TOWFIGH NIA: Sehen Sie momentan, dass Russland in dieser Hinsicht, was die Befriedung Libyens angeht, eine konstruktive Rolle spielt?
BURGER: Das ist, wie gesagt, die Erwartung, die wir an alle haben, die in Libyen Einfluss haben. Das ist auch das, was wir in unseren bilateralen Gesprächen mit den Staaten, um die es dabei geht, sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Ich glaube, insgesamt verrate ich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir mit dem Zustand, wie er in Libyen derzeit herrscht, überhaupt nicht zufrieden sein können. Weder das Waffenembargo wird so eingehalten, wie es die Resolutionen des Sicherheitsrats vorsehen, noch ist vor Ort der vereinbarte Waffenstillstand tatsächlich zu beobachten. Deswegen befinden wir uns weiter im Gespräch mit allen, die dort Einfluss haben, und bemühen uns darum und drängen sie dazu, ihren Einfluss nun endlich im richtigen Sinne geltend zu machen.
FRAGE: Ich habe eine Nachfrage zur Corona-Warn-App, die 9,6 Millionen Mal heruntergeladen werden konnte, aber auf vielen älteren Geräten dann doch nicht funktioniert. Gibt es Überlegungen, ob man doch noch einmal Gespräche mit Google und Apple darüber sucht, ob sie diese Schnittstelle nicht auch kompatibel mit anderen Betriebssystemen machen können, also für alle iPhones 6 oder ältere iPhones, oder ist das definitiv ausgeschlossen?
SRS’IN DEMMER: Die Unternehmen und auch die Kabinettsmitglieder, die die App am vergangenen Dienstag vorgestellt haben, haben ja deutlich gemacht, dass es sich hierbei um einen iterativen Prozess handelt. Nichts ist also in Stein gemeißelt. Man hat diese Version, die jetzt seit Dienstag funktioniert, in einem wahnsinnigen Tempo an den Start gebracht, und trotzdem wird es weitere Verbesserungsmöglichkeiten geben. Man wird weiter daran arbeiten, und darüber werden wir Sie auf dem Laufenden halten.
FRAGE JESSEN: Frau Demmer, es ist ja ich glaube, in Berlin gesagt worden, die App sei in der Anwendbarkeit nur für höher entwickelte und teurere Systeme geeignet und sozusagen ein Spielzeug für die digitale Elite, das aber von denen, die es eigentlich dringender bräuchten, häufig genug nicht angewendet werden könne. Verfolgt die Bundesregierung die feste Absicht und den Willen, dass diese App auch auf älteren Smartphones verwendet werden kann? Sonst können diejenigen, die sie vielleicht besonders dringend nutzen müssten, gar nicht nutzen. Dann zielt das, so schön die Zahl ist, einfach am Zweck entscheidend vorbei!
SRS’IN DEMMER: Ich glaube, Sie können selbstredend davon ausgehen, dass es der Wille der Bundesregierung ist, dass natürlich möglichst viele Menschen diese App nutzen können, und daran arbeiten wir.
ZUSATZFRAGE JESSEN: Das heißt also, Sie hoffen oder Sie fordern, dass diese App in Zukunft auch für ältere Smartphonegenerationen als ein iPhone 6 eingesetzt werden kann. Ist das eine Forderung der Bundesregierung?
SRS’IN DEMMER: Wie gesagt: Wir arbeiten ja sehr kooperativ mit den beiden Unternehmen zusammen, die diese App im Auftrag der Bundesregierung entwickelt haben. Selbstredend ist es das Ziel, dass die App auf möglichst vielen Geräten funktionsfähig ist; das ist doch selbstverständlich.
FRAGE RATZSCH: Hält es die Bundesregierung für richtig, dass bei Ereignissen wie jetzt rund um Tönnies in Gütersloh sofort in einem großen Umkreis wieder alle Schulen und Kitas geschlossen werden?
GÜLDE: Das sind Entscheidungen, die tatsächlich die Landesbehörden vor Ort treffen und die sie auch dem Ausbruchsgeschehen entsprechend einfach selbstständig treffen. Wir begrüßen natürlich sämtliche Maßnahmen, die zu einer Unterbrechung von Infektionsketten führen.
SRS’IN DEMMER: Vielleicht kann ich dazu noch einmal etwas sagen. Grundsätzlich verdeutlichen die erneuten Ausbrüche ja, dass die Pandemie einfach noch nicht vorbei ist, dass die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln einfach nach wie vor essenziell ist und dass es gerade bei Unternehmen, bei denen so viele Menschen auf engem Raum zusammenarbeiten und untergebracht sind, weiterhin schlüssiger Hygienekonzepte bedarf.
In Gütersloh geht es jetzt vor allem darum, dieses doch sehr schwere Ausbruchsgeschehen unter Kontrolle zu bringen. Die Bundesregierung steht dazu auch mit der Landesregierung in engem Kontakt und Austausch.
FRAGE: Die weißrussische Regierung hat gestern die Botschafter der EU-Länder zu einem längeren Gespräch in das Außenministerium in Minsk bestellt. Können Sie uns sagen, worum es in diesem Gespräch ging?
BURGER: Dazu muss ich Ihnen die Antwort nachreichen.
FRAGE DR. RINKE: Meine Frage geht an das Finanzministerium, und zwar geht es um Wirecard. Ich hätte ganz gerne gewusst, Herr Kuhn, ob sich das Finanzministerium Sorgen um das Image des Finanzstandorts Deutschland macht, wenn ein DAX-Konzern so dramatisch abstürzt und ihm Unregelmäßigkeiten vorgeworfen werden. Das ist die eine Frage.
Die zweite Frage: Es gibt Vorwürfe, dass die BaFin ihre Aufsichtspflichten nicht wirklich erfüllt hat und Wirecard dafür ein Beispiel ist. Vielleicht können Sie das kommentieren.
DR. KUHN: Wir äußern uns wie üblich nicht zu einzelnen Unternehmen. Für die Aufsicht ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die BaFin, zuständig, wie Sie es angesprochen haben. Die geht allen relevanten Hinweisen in allen Fällen entschieden nach. Unabhängig von jetzigen Einzelfällen verurteilt das Bundesfinanzministerium natürlich jede Form von Manipulation und Betrug.
ZUSATZFRAGE DR. RINKE: Und zur ersten Frage? Machen Sie sich Sorgen um das Image des Finanzstandorts Deutschland?
DR. KUHN: Das hängt ja jetzt unmittelbar mit dem Unternehmen zusammen, deswegen kommentieren wir das in diesem Kontext jetzt nicht.
ZUSATZFRAGE DR. RINKE: Entschuldigung, aber ich will jetzt keine unternehmensbezogene Antwort haben, sondern eine für den Finanzstandort, und da müsste sich das Finanzministerium doch zuständig fühlen.
DR. KUHN. Dafür sind wir natürlich auch zuständig. Wir arbeiten hier eng mit der BaFin und der Bundesbank zusammen und achten darauf, dass wir einen gesunden und wettbewerbsfähigen Finanzstandort haben.
ZUSATZFRAGE DR. RINKE: Noch einmal an das Finanzministerium, aber auch an das Wirtschaftsministerium, zum Thema Lufthansa: Gab es konkrete Anfragen des Investors Thiele nach Gesprächen mit den Ministern, und gibt es Planungsgespräche von Ministeriumsmitarbeitern mit diesem Investor über die Zukunft von Lufthansa?
WAGNER: Ich kann gerne anfangen. Herr Rinke, den Stand kennen Sie so weit: Die Bundesregierung hat dem Unternehmen Lufthansa ein umfassendes Unterstützungspaket angeboten. Das Unterstützungspaket wurde vom Aufsichtsrat angenommen und der außerordentlichen Hauptversammlung zur Annahme vorgeschlagen. Die muss noch darüber befinden, und auch die Europäische Kommission als Beihilfegenehmigungsbehörde muss noch darüber befinden. Das ist der Stand des Verfahrens.
Wir bitten um Verständnis, dass wir zu etwaigen Verfahrensschritten, Gesprächen etc. in solchen Verfahren grundsätzlich keine Auskunft geben. Das gilt auch in diesem Fall, sodass wir weder etwaige Gespräche bestätigen oder dementieren noch kommentieren können. Es gilt, dass wir über presseöffentliche Termine informieren, wenn sie stattfinden, und im Übrigen über laufende Verfahren gerade in sensiblen Bereichen, wenn es um Unternehmen geht, nicht umfänglich Auskunft geben können. Wenn es etwas zu berichten gibt, werden wir das selbstverständlich tun.
DR. KUHN: Der Bundesfinanzminister war ja am Mittwoch zum Nachtragshaushalt hier und hat sich dabei auch zum Rettungspaket geäußert. Er hat dabei noch einmal betont, dass der Bund hier ein gutes Angebot auf den Tisch gelegt hat.
Im Übrigen kann ich mich dem anschließen, was der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums gesagt hat, nämlich dass wir uns zu eventuellen Gesprächen im weiteren Verfahren nicht weiter äußern bzw. das nicht kommentieren.
FRAGE: An das Innenministerium zu einem Termin in der nächsten Woche: Da gibt es einen Festakt zur Gründung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Können Sie einmal umreißen, was genau die Aufgabe dieser Stiftung sein wird und inwieweit sie zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland beitragen kann und soll?
Direkt noch eine Zusatzfrage: Neben Innenminister Seehofer werden auch die Ministerinnen Giffey und Klöckner teilnehmen. Was erwarten sich denn das Familienministerium und Landwirtschaftsministerium von dieser Stiftung?
DR. LAMMERT: Vielen Dank. Ich fange vielleicht einmal an, und die Kollegen können dann weitermachen. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist ja ein gemeinsames Vorhaben der drei Häuser. Sie ist ein zentrales Ergebnis der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ und soll vor allem in strukturschwachen und ländlichen Regionen Engagement sinnvoll und nachhaltig unterstützen. Sitz der Stiftung ist die Stadt Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern, und dort wird nächste Woche auch der Festakt für die feierliche Gründung stattfinden.
Vielleicht ganz kurz zu den Aufgaben: Mit der Stiftung wird das starke und vielfältige bürgerschaftliche Engagement und Ehrenamt von rund 30 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland anerkannt und wertgeschätzt. Zum ersten Mal wird es mit der Stiftung eine bundesweite Anlaufstelle geben, die ehrenamtlich Engagierte unterstützt. Die Aufgaben sind vielfältig. Ein Schwerpunktthema ist die Digitalisierung und die Unterstützung der Digitalisierung. Außerdem wird es Informationsangebote geben, um erprobte Konzepte möglichst schnell austauschen zu können. Eine Art „best practice“ soll etabliert werden. Die Stiftung wird auch Nachwuchsgewinnung unterstützen und Fortbildung anbieten. Ab 2021 sind finanzielle Mittel in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro jährlich für die Stiftung vorgesehen.
KEMPE: Ich kann für das Bundesfamilienministerium vielleicht noch ergänzen, dass uns gerade die einschneidenden Auswirkungen jetzt in der Coronakrise gezeigt haben, dass diese vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die es da gibt, eine Stiftung für Engagement und Ehrenamt für unsere Gesellschaft sozusagen unverzichtbar machen. Die Ministerin hat sich dazu auch geäußert und gesagt: „Gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten kann die Stiftung mit ihrem Schwerpunkt Digitalisierung wegweisende Impulse setzen und Engagement konkret vor Ort deutschlandweit unterstützen“.
BRANDT: Die Bundesministerin ist natürlich auch zuständig für die ländlichen Räume, und das Ehrenamt ist ein ganz wichtiger Standortfaktor, weil dort vieles über ehrenamtliche Strukturen und nachbarschaftliche Hilfe läuft. Insofern ist diese Stiftung auch sehr wichtig für uns. Es ist einfach ein Kitt, der die Gesellschaft in diesem Bereich zusammenhält. Wir haben zum Beispiel auch andere Projekt wie „Hauptamt stärkt Ehrenamt“. Dabei werden den Ehrenamtlichen hauptamtliche Strukturen zur Seite gestellt, um die Menschen vor Ort noch besser zu unterstützen. Ansonsten kann ich mich den Kollegen nur anschließen.
FRAGE JESSEN: An das Innenministerium in der Folge zur Innenministerkonferenz: Dort wurde ja klargestellt, dass das neue Berliner Antidiskriminierungsgesetz ausschließlich für Berliner Beamte gelten soll und dass Polizeibeamte aus anderen Bundesländern nach der Rechtslage des jeweiligen Dienstherrn behandelt werden. Ist es eigentlich gut und richtig für das Rechtsbewusstsein und das Rechtsgefühl der Bevölkerung, wenn jemand, der sich durch Polizeieinsatz diskriminiert fühlt, nicht mehr nach dem Ereignisgeschehen seine Rechte definieren kann, sondern schauen muss, welche Kokarde der jeweilige Polizeibeamte trägt und wo er herkommt. Das ist ja ein Messen mit zweierlei Maßstäben.
Zweite Frage: Bedeutet das im Umkehrschluss eigentlich, dass, wenn Polizeibeamte aus Berlin in einem anderen Bundesland eingesetzt werden, im Zweifelsfalle nach dem Berliner Gesetz von Menschen, die sich falsch behandelt fühlen, gegen sie vorgegangen werden kann?
DR. LAMMERT: Ich kann dem, was der Bundesinnenminister in den letzten Tagen bereits am Rande der Innenministerkonferenz gesagt hat, eigentlich nicht viel hinzufügen. Eine solche Regelung, wie sie in Berlin eingeführt wurde, ist aus unserer Sicht abzulehnen, weil es hier das Risiko eines Generalverdachts und einer Beweislastumkehr gibt. Ich möchte jetzt aber auch nicht zu viel zusätzlich sagen. Es läuft zurzeit eine Pressekonferenz der Innenministerkonferenz, und der Bundesinnenminister wird sich zu diesem Thema sicherlich noch einlassen.
ZUSATZFRAGE JESSEN: Meine Hoffnung war, dass Sie dazu hier schon etwas sagen können, weil wir ja nicht an dem Ort sind. Das mögen Sie nicht tun?
DR. LAMMERT: Nein, ich würde jetzt auf die Innenministerkonferenz verweisen, dort läuft zurzeit die Pressekonferenz.
ZUSATZFRAGE JESSEN: Können Sie die zweite Frage beantworten, also ob das dann bedeutet, dass, wenn Berliner Polizeibeamte in anderen Bundesländern eingesetzt werden, sie dort gegebenenfalls nach Berliner Recht behandelt werden können?
DR. LAMMERT: Diese Information liegt mir nicht vor, das muss ich gegebenenfalls nachreichen.
ZUSATZFRAGE JESSEN: Ich hätte noch eine Frage an das Bundeswirtschaftsministerium ich hoffe, dass mir die Antwort nicht entgangen ist : Es geht um den Sonderfall, dass die Erstattung von Beratungskosten in der Coronakrise für Kleinunternehmer ich glaube, die Höchstsumme betrug dabei 4000 Euro zum Teil missbräuchlich eingesetzt worden ist, weswegen dieser Topf dann eingefroren wurde. Allerdings war das offenbar ein internes Einfrieren, sodass die Information darüber gar nicht kommuniziert wurde, sodass es Fälle gab, in denen Menschen, die Beratungsbedarf hatten, sich in Unkenntnis des Einfrierens noch einmal auf Beratungen eingelassen haben. Stimmt diese Information so? Wenn das so ist, warum war das so?
WAGNER: Da würde ich gerne ein bisschen etwas geraderücken, weil ich glaube, dass da in der Berichterstattung etwas schief Ich habe die Berichte nicht gesehen, aber das ist auf jeden Fall nicht ganz, wie es wirklich ist.
Tatsächlich hat das Bundesministerium für Wirtschaft zu dem Zeitpunkt, als die Coronakrise richtig eingeschlagen hat und Unternehmen unter größten Schwierigkeiten geschaut haben, wie sie ihr Geschäftsmodell auch in der jetzigen Zeit weiter betreiben können und welche Auswirkungen die Coronakrise gegebenenfalls auch mittel- und langfristig auf bestimmte Geschäftsfelder und Modelle hat, über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das BAFA, ein Förderprogramm aufgelegt, an das sich gerade kleine und mittlere Unternehmen wenden konnten, um dort Beratungen anzunehmen und zu finanzieren, die eben helfen sollten, genau diese Geschäftsmodelle zu entwickeln und gegebenenfalls weiterzuentwickeln.
Das ist ein weiteres Modul, das an ein schon bestehendes Programm angehängt wurde. Dieses Programm hat verschiedene Module, die sich bezüglich der Beratung an kleine und mittelständische Unternehmen richten. Diese Module gelten weiterhin. Es wurde vorübergehend ein zusätzliches Modul geschaffen, um genau diesen zusätzlichen Mehrbedarf im Rahmen der Corona-Beratung abzudecken.
Zu diesem Zweck wurde ein Haushaltstitel geschaffen. Ich glaube, es sind rund 15 Millionen Euro für bis zu 4000 Euro Beratungskosten vorgesehen. Das Verfahren war und ist so, dass diese Anträge gestellt werden können. Diese Gelder werden aber nicht unmittelbar bewilligt das ist üblich und auch im Rahmen dieses Programms so , sondern sie werden unter bestimmten Voraussetzungen in Aussicht gestellt. Das heißt, es muss nach der Beratung genau dargelegt werden, für was das Geld ausgegeben wurde, ob sich das Unternehmen an die Richtlinie des BAFA gehalten hat, sprich, dass es tatsächlich auch nur erstattungsfähige Beratungsleistungen waren, zum Beispiel eine reine Finanzierungsleistung. Wenn der Berater gesagt hätte „Richten Sie sich bitte an die KfW, und dort gibt es folgende Programme“, wäre das zum Beispiel nicht förderfähig gewesen, sondern es ging tatsächlich um ganz speziell genannte Beratungsbereiche. Das Unternehmen, dem quasi die Beratung und Förderung in Aussicht gestellt wurde, muss das eben genau darlegen und auch, dass die Beratung tatsächlich erfolgt ist.
Es gab tatsächlich eine sehr große Nachfrage, sodass erst einmal intern gesagt wurde: Wir können keine weiteren Aussichtstellungen vergeben. Das heißt also, dass niemandem erst einmal die Hoffnung gemacht wurde. Gleichwohl wurde das nicht sofort gestoppt, sondern es sind noch zwei oder drei Wochen vergangen, bis es die offizielle Einstellung gab. Hintergrund ist, dass es Überlegungen gab, das zu verlängern. Der andere Punkt ist: Man kann nicht aus dem reinen Haushaltstitel darauf schließen, wie viele Unternehmen man am Schluss tatsächlich fördern und das in Aussicht stellen kann, denn das hängt natürlich davon ab, ob tatsächlich die Beratungen in der vollen Höhe entstanden und förderfähig gewesen sind. Das heißt, Sie können erst am Schluss abrechnen, wie viel Sie in Aussicht stellen und fördern können, sodass das ein bisschen auseinanderfällt.
Ich hatte in der Presseberichterstattung auch einen Fall gesehen, bei dem es darum ging, dass der Berater einem Antragsteller versprochen hatte, dass er diese Fördergelder im Rahmen einer Beratung, die schon nach der Förderrichtlinie ganz klar ausgeschlossen war, bekommt. Das ist natürlich etwas, was geprüft wird. Für eine Förderung, die gar nicht förderfähig war, wird natürlich auch kein Geld ausbezahlt, sodass eigentlich ein Betrug ausgeschlossen werden kann.
ZUSATZFRAGE JESSEN: Danke für die ausführliche Darlegung. Der Kern der Frage bezieht sich aber darauf, dass es ich formuliere es jetzt einmal so Geschädigte gibt, vielleicht Geschädigte durch unseriöse Berater. Die sagen aber: Wenn wir rechtzeitig gewusst hätten, dass dieses Programm zum Beispiel gestoppt wird und dass gar nichts mehr weiter kommt, dann hätten wir uns auf so einen Deal gar nicht eingelassen. Hat nicht Ihr Haus oder haben nicht die untergeordneten Institutionen und Ämter nicht doch ein Stück weit eine Verantwortung dafür, wenn wegen relativ später Information über das Einstellen und Nichtfortführen des Programms möglicherweise Menschen in Fallen getappt sind?
WAGNER: Wie gesagt, die Inaussichtstellung dieser Beratung oder dieser möglichen Förderung wurde schon relativ früh beendet. Tatsächlich wurde auf der Website über das Programm informiert. Das Verfahren sah vor: Wenn es keine Inaussichtstellung gibt, dann kann ich auch nicht darauf vertrauen, dass ich nachher eine Förderung bekomme. Das ist schon zu unterscheiden.
Tatsächlich haben viele noch Anträge gestellt. Denen wurde aber gesagt, dass derzeit keine Inaussichtstellungen möglich sind. Das heißt, wer in der Zeit tatsächlich eine Beratung begonnen hat, konnte sozusagen wissen, dass er diese Inaussichtstellung nicht bekommen hat.
Was ich nicht beurteilen kann, ist das Verhältnis zwischen Beratern und dem jeweiligen Unternehmen und was dort kommuniziert wurde. Das liegt aber nicht im Verantwortungsbereich des BMWi oder auch des BAFA, sondern das muss in jedem Einzelfall genau nachvollzogen werden, wenn, wie Sie sagen, ein betrügerischer Berater unterwegs ist. Das BAFA kann nur ausschließen, dass dieser betrügerische Berater später eine Beratung abrechnet. Es kann ja nicht kontrollieren, was der Berater dem Unternehmen sagt und gegebenenfalls Informationen gibt, die nicht zutreffend sind, und somit in eine Beratung lockt, die nachher nicht förderfähig ist. Ich denke, da gibt es bestimmt zivilrechtliche Ansprüche und zivilrechtliche Möglichkeiten, dass man in jedem Einzelfall genau auseinandersetzt, was tatsächlich geschuldet wird.
Noch der Hinweis: Es gibt weiterhin Beratungen zum Thema Corona und Unternehmensberatungen im Bereich des BAFA. Wie gesagt, nur im Rahmen dieses einen Moduls sind keine weiteren Anträge möglich, weil es ausgeschöpft ist. Es gibt aber noch andere Module, die solche Beratung anbieten und an die sich Unternehmen wenden können.
FRAGE TOWFIGH NIA: Herr Burger, eine ganz kurze Frage zum Thema Syrien. Die USA haben neue Sanktionen verhängt. Gibt es darauf vonseiten des AA eine Reaktion?
BURGER: Diese neuen US-Sanktionen fordern Rechenschaft des Regimes für die Repressionen und für begangene Kriegsverbrechen. Sie setzen ein Zeichen gegen eine verfrühte Normalisierung.
Das Regime zeigt weiterhin keinerlei Bereitschaft zu Zugeständnissen, blockiert seit Jahren den von den Vereinten Nationen geführten politischen Prozess und macht immer wieder auf zynische Weise klar, dass es kein Interesse an einer friedlichen Lösung des Konflikts hat. Solange das syrische Regime sein brutales Verhalten nicht ändert und seine schwerwiegenden Verstöße gegen die Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht nicht beendet, kann es keine Aufhebung der Sanktionen geben.
Gleichzeitig ist klar: Welche Maßnahmen auch immer verhängt werden, sie dürfen nicht zu Lasten der Zivilbevölkerung gehen, die in den letzten neun Jahren schon unermessliches Leid erfahren hat. Auch die EU hat ja restriktive Maßnahmen im Syrienkontext gegen bestimmte Personen und Identitäten verhängt, die sich in Syrien schwerer Verbrechen schuldig gemacht haben oder die von den kriegerischen Handlungen profitieren. Diese Sanktionen sind gezielt und haben keine negativen Auswirkungen auf die Versorgung der Zivilbevölkerung, weil dort klare humanitäre Ausnahmen vorgesehen sind. Diese humanitären Ausnahmen funktionieren auch. Das haben wir in der Coronakrise gesehen.
Wenn ich darf, hätte ich noch eine Nachlieferung, die sich auf Ihre Frage nach Belarus bezieht.
Ja, es hat gestern ein Gespräch des belarussischen Außenministers mit den Botschaftern der EU-Mitgliedstaaten der EU, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten gegeben. Gegenstand waren die Vorgänge um die Verhaftung von Wiktor Barbariko.
Falls Sie das interessiert, kann ich Ihnen kurz die Beurteilung der Bundesregierung zu diesen Vorgängen sagen.
Wir beobachten diese jüngste Eskalation im Wahlkampf in Belarus mit großer Sorge. Die Verhaftung des potenziellen Kandidaten Barbariko wirft zahlreiche ernsthafte Fragen hinsichtlich der Voraussetzungen für faire und freie Wahlen in Belarus auf. Politisch motivierte Strafverfolgung zur Ausschaltung politischer Gegner wäre ein schwerer Rückschlag für Meinungsfreiheit und Demokratie in Belarus. Diejenigen, die sich im politischen Gewahrsam befinden, müssen einem fairen und rechtsstaatlichen Verfahren unterzogen werden. Grundsätzlich sollten alle Kandidaten, die Kriterien wie etwa die erforderliche Zahl an Unterschriften vorweisen, zur Wahl zugelassen werden.
Wir rufen die belarussische Regierung mit Nachdruck auf, freie und faire Wahlen im Einklang mit den geltenden Standards der OSZE zu gewährleisten. Dessen Grundpfeiler sind das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie das Recht, sich friedlich zu versammeln. Die Verhaftungen der letzten Wochen und Monate drohen dem eklatant entgegenzustehen.
FRAGE: Wenn ich noch eine Frage stellen dürfte, die die Kollegen mir gerade übermitteln, nämlich zu Flüchtlingskindern aus Griechenland. Inwieweit wissen Sie, welche anderen EU-Staaten genauso wie Deutschland bereit sind, Flüchtlingskinder aufzunehmen. Wie sieht der zeitliche Plan aus? Wann werden sie kommen?
DR. LAMMERT: Danke für die Frage. Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung zugesagt, im Rahmen eines europäischen Vorgehens mindestens 350 betroffene Kinder von den griechischen Inseln aufzunehmen. An der Umsetzung wird intensiv gearbeitet. Der Rückgang der Coronapandemie erlaubt jetzt eben auch ein rascheres Vorgehen.
Der Bundesinnenminister hat letzte Woche angekündigt, dass zusätzlich zu der ersten Gruppe von 47 Kindern in den nächsten Wochen die Überstellung von 243 erkrankten Kindern erfolgen soll. Die ersten 47 waren unbegleitete Minderjährige; hinzukommen noch weitere sechs unbegleitete Minderjährige, die kurz vor der ersten Überstellung erkrankt waren und nicht kommen konnten.
Es zeichnen sich aber jetzt auch weitere Aufnahmen durch unsere europäischen Partner ab. Finnland, Portugal, Irland und Frankreich haben angekündigt, in den nächsten Wochen mit den ersten Transfers zu beginnen. Insgesamt haben sich 12 EU-Mitgliedstaaten zur Aufnahme von Kindern von den griechischen Inseln bereiterklärt.
ZUSATZFRAGE: Ist schon klar, inwieweit sie innerhalb von Deutschland verteilt werden? Was Thüringen angeht, ist das ja schon bekannt.
DR. LAMMERT: Für die Verteilung der aufzunehmenden Personen hat sich der Bund mit den Ländern auf ein Konzept verständigt, das nach dem Kindeswohl und auch nach familiären Bindungen vorgeht, aber auch darüber hinaus die Aufnahmebereitschaft der Länder berücksichtigt. Es muss aber noch geklärt werden, wie genau die Verteilung stattfindet.
FRAGE: Wissen Sie schon, wann die Kinder in welcher Stadt ankommen?
DR. LAMMERT: Nein. Ziel ist es, in den nächsten Wochen die Überstellung vorzunehmen.